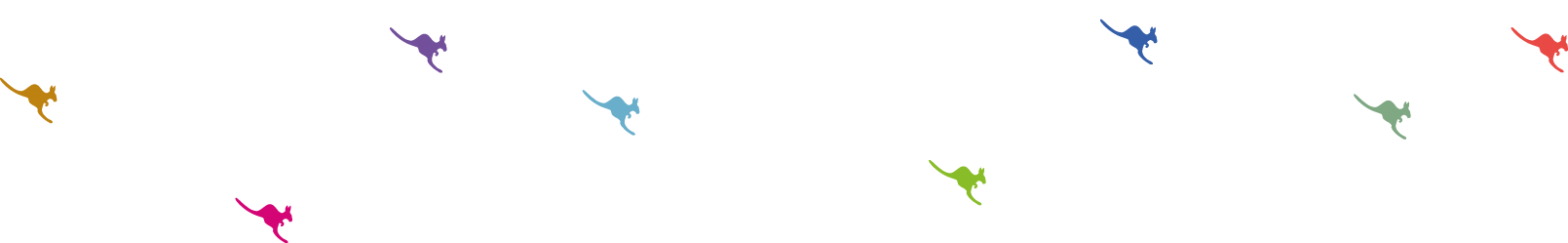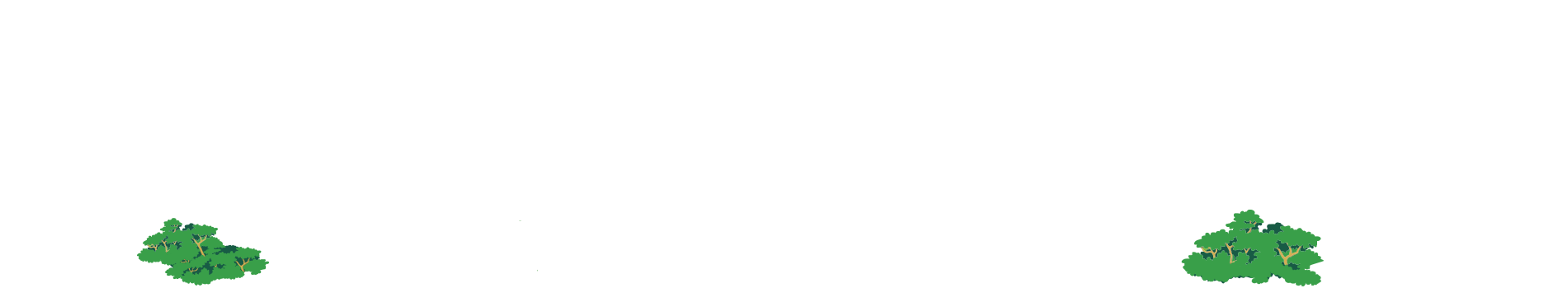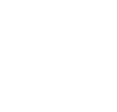B - Idee des "bewegungsfreudigen" Kindergartens
„Wir Deutschen glauben immer, alle
Schulerziehung durch Aufklärung bewirken
zu können, durch Worte oder Bücher, durch
bloße Belehrungen.“
Georg Kerschensteiner
Die Vorstellung und die Organisation von Lernprozessen in unserer Gesellschaft scheinen untrennbar mit Sitzen und Belehrung verbunden zu sein. Konzentration und Lernerfolg hängen vermeintlich von körperlicher Starre und Unbeweglichkeit ab. Nach dieser Vorstellung funktionieren leider noch die meisten Bildungseinrichtungen. Zugespitzt: ´Wenn alles schweigt und einer spricht, das nennt der Mensch dann Unterricht!´.
Für den Kindergarten kann eine solche Vorstellung kein Vorbild sein.
Die körperliche, soziale und intellektuelle Entwicklung von Kindern vollzieht sich nur zu einem geringeren Teil über bewusste Erziehungsmaßnahmen und verbale Belehrungen oder Anleitungen. Kinder können nicht belehrt werden, sie können nur selber lernen. Dabei sind sie aktiv schlussfolgernde Denker, die hinter die Dinge schauen wollen. Höchst bedeutsam sind die praktischen Erfahrungen, die Kinder in ihrem Alltag machen. Wichtig ist daher eine positiv aktivierende soziale und natürliche Umwelt, in der das lebenspraktische Handeln ausgeübt wird. Sie bestimmt über Richtung und Qualität der Erfahrungen, die Kinder machen können.
Außerhalb der Familie ist der Kindergarten zu dem zentralen Ort geworden, wo Kinder ihren Alltag erleben und Erfahrungen gewinnen. Der Kindergarten als Erziehungs- und Bildungsinstitution außerhalb der Familie trägt in dem skizzierten Problemzusammenhang eine besondere Verantwortung. Hier ist es am ehesten möglich, zivilisationsbedingten Bewegungsmangel und die damit verbundenen Folgen auszugleichen. Im Kindergarten kann Kindern im wahrsten Sinne des Wortes Bewegungsraum gegeben werden. Bewegungsraum, der alle Sinne anspricht, Chancen für vielfältige Wahrnehmungs- und Lerngelegenheiten eröffnet sowie die ganzheitliche Entwicklung von Kindern fördert.
In einem solchen Haus werden Bewegung, Wahrnehmung und Kommunikation als elementare Erkenntnis- und Ausdrucksmöglichkeiten von Kindern betrachtet und in den Mittelpunkt der pädagogischen Arbeit gestellt. Ziel ist es, Kindern mehr Raum für Bewegungsspiele, für Sinneserfahrungen und für intellektuelle Leistungen zu verschaffen, die damit verbunden sind bzw. verbunden werden können. Der Kindergarten wird zu einem Handlungs- und Erfahrungsraum, der Kindern vielseitige Anregungen und Impulse zum Lernen gibt.
Die Idee einer bewegungsfreudigen Kindertagesstätte oder des Bewegungskindergartens ist nicht neu und sie ist auch nicht die Erfindung der Sportjugend Berlin. In anderen Bundesländern und in anderen Kommunen existieren solche Einrichtungen bereits.
Zum Teil sind Bewegungskindergärten auch wissenschaftlich begleitet und ihre Arbeit der Evaluation unterzogen worden. Die Ergebnisse sind verblüffend und lassen sich kurz auf den Punkt bringen: „Kinder, die in einem bewegungsfreundlichen Umfeld leben, zeigten hinsichtlich der motorischen Entwicklung insgesamt bessere Ergebnisse als die Kinder, deren häusliches Umfeld weniger bewegungsfreundlich war. Die besten Ergebnisse im Motoriktest hatten die Kinder, die den Sportkindergarten besuchten. Insbesondere die Koordinationsfähigkeit hatte sich bei ihnen verbessert. Aber auch hinsichtlich der sozialen Entwicklung schnitten die Kinder des Sportkindergartens besser ab. Sie waren rücksichtsvoller, hilfsbereiter und kooperativer…..Die Kinder profitierten nicht nur in ihrer Bewegungsentwicklung, sondern vor allem auch in der intellektuellen Entwicklung von den regelmäßigen Bewegungsangeboten.“
Ein anderes Beispiel für Kinder im Grundschulalter macht derzeit Furore. Eine Grundschule im hessischen Bad Homburg hat Ende der neunziger Jahre die tägliche Bewegungszeit und Sportstunde für alle Schüler zur Pflicht gemacht – auf Kosten anderer Fächer und anfänglich gegen Vorbehalte und Protest vieler Lehrer. Die wissenschaftlichen Ergebnisse der Begleituntersuchung zeigen, dass Gewaltphänomene und Raufereien auf dem Schulhof sowie Unfälle und Verletzungen deutlich zurückgingen. Die Konzentration der Schüler im Unterricht nahm deutlich zu, Lernstörungen verringerten sich. Die Schule empfiehlt heute ca. 15 Prozent mehr Schüler für das Gymnasium als vor Einführung der täglichen Bewegungszeit.
Die Beispiele deuten an, wie in unserer Gesellschaft die Entwicklungsbedingungen für Kinder verbessert werden können. Das sollte Vorbild auch für Berlin sein.